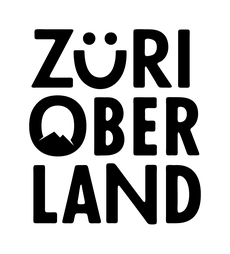Mühle Niederuster

Auf das ehhafte Wasserrecht der Mühle Niederuster gehen die Werke der Zellweger AG und der Lenzlinger AG zurück. Das heutige Mühlengebäude stammt von 1820, 1842 kam die Mühlenscheune mit den Rundbogentoren dazu. 1824 baute Heinrich Kunz an Stelle der oberen Nebenmühle seine zweite Grossspinnerei. Auf die Kunzsche Spinnerei geht die 1918 gegründete Apparate- und Maschinenfabrik Zellweger Uster AG zurück (heute Uster Technologies AG). 1883 machte die Mühle Konkurs und die Gebrüder Lenzlinger erwarben die Anlagen. Ab 1888 betrieben sie eine Transmissionsanlage zur Kraftübertragung in ihre benachbarte Sägerei.
Auf die mittelalterliche Mühle von Niederuster und ihr ehhaftes (das heisst: zinsfreies, an den Standort der Mühle gebundenes und nicht ablösbares) Wasserrecht gehen die ausgedehnten Werksanlagen der Zellweger AG (heute Uster Technologies) und der Lenzlinger AG zurück. Die Mühle scheint im 13. Jahrhundert als Besitz der Grafen von Rapperswil entstanden zu sein und ist im Jahr 1350 erstmals zuverlässig als Eigentum des Adligen Hermann von Landenberg nachzuweisen.
Nach verschiedenen Besitzerwechseln kam sie 1804 an Müller Heinrich Herter. 1819 brannte das Gebäude ab, wobei ein Knabe ums Leben kam. 1820 stand die neue, heutige Mühle. 1841 erwarb Johann Heinrich Berchtold die Anlage und liess 1842 die neue Mühlenscheune mit den Rundbogentoren bauen.
Müller Herter verschuldete sich für seinen Neubau. Er verkaufte die Liegenschaft seiner oberen Beimühle an Heinrich Kunz, den zukünftigen «Spinnerkönig». Dabei handelte es sich um eine Nebenmühle, die oberhalb der Mühle am Mühlekanal gelegen war und einen eigenen Wasserkraftantrieb besass. Dort baute Heinrich Kunz 1824 seine zweite Grossspinnerei und liess ohne Bewilligung auch einen Stauweiher als Ausgleichsbecken anlegen, den heutigen «Zellwegerweiher». So hatte er immer Wasser für sein Kraftwerk. Der Müller hingegen wurde damit von ihm abhängig und konnte nur noch das Wasser nutzen, das nach dem Füllen des Weihers ablief. Der Streit zwischen Herter und Kunz und ihren Nachfolgern um das Abgraben des Wassers dauerte 50 Jahre. 1874 baute Heinrich Bünzli, der dritte nachfolgende Inhaber der Mühle Niederuster, schliesslich seinen eigenen Weiher, den heutigen «Herterweiher», und machte sich vom Zufluss aus dem «Zellwegerweiher» unabhängig. Auf die Kunzsche Spinnerei aber geht die 1918 gegründete Apparate- und Maschinenfabrik Zellweger Uster AG zurück (heute Uster Technologies AG), die zum grössten Industriebetrieb der Gegend anwuchs.
Ebenfalls 1824 wurde die Mühle durch eine untere Beimühle ergänzt, deren Wasserrad eine Dreschmaschine antrieb. Herter ersetzte damit die obere Beimühle, die er an Heinrich Kunz verkauft hatte. 1862 erwarb Heinrich Zollinger die untere Beimühle vom Nachbesitzer der Mühle, Johann Heinrich Berchtold, und baute an ihrer Stelle eine Zwirnerei. Diese wurde zuerst noch durch ein Wasserrad, ab 1904 durch eine Francis-Turbine angetrieben. Sie machte 1983 einer Wohnüberbauung Platz.
1883 machte Heinrich Bünzli mit der Mühle Konkurs und die Gebrüder Lenzlinger erwarben die Anlagen. 1888 ersetzten sie die beiden Wasserräder der Mühle durch ein stärkeres neues, das 5,1 m Durchmesser hatte, und betrieben damit eine Transmissionsanlage zur Kraftübertragung in ihre benachbarte Sägerei. 1896 wurde das Wasserrad durch eine Rieter-Jonval-Turbine ersetzt, die die Transmissionsanlage bis 1965 antrieb. Mit Lenzlinger teilten schliesslich vier Unternehmen die Ausnutzung derselben Gefällsstufe des Aabachs. 1983 renovierte die Firma Lenzlinger Söhne AG die Mühle.
Quellen und Literatur
H.-P. Bärtschi, Die Mühle Niederuster im 19. Jahrhundert, in: Aabach und Mühle Niederuster. Ein Beitrag zur Industriegeschichte des Zürcher Oberlandes. Uster 1985, 60–75.
H.-P. Bärtschi, Der Industrielehrpfad Zürcher Oberland. Wetzikon 1994, 20.
H.-P. Bärtschi, Uster – ein Begleiter zu Orten der Industriegeschichte. Uster 2007, Standort 5A.
H.M. Gubler, Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich. Die Bezirke Pfäffikon und Uster, Bd. III. Basel 1978, 418–420.
B. Schmid, Die Mühle Niederuster bis 1798, in: Aabach und Mühle Niederuster. Ein Beitrag zur Industriegeschichte des Zürcher Oberlandes. Uster 1985, 39–59.
P. Ott, arbeiten und leben am Millionenbach. Uster 2019, 128–141.
(Cornel Doswald, 2024)