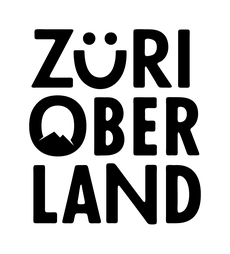Konsum

Mitte des 19. Jahrhunderts veränderten sich die Konsumgewohnheiten radikal. Einer, der schon früh gemerkt hat, dass etwas verändert werden muss, war der Glarner Fabrikant Jean Jenny-Ryffel aus Schwanden. Als Textilfabrikant pflegte er intensive Geschäftsbeziehungen zu England, dem Mutterland der Webmaschinen. Auf seinen zahlreichen Reisen beobachtete er die dortigen sozialen Zustände sehr genau. Dabei lernte er die «cooperative stores» in Rochdale kennen, Lebensmittelläden, die von Arbeitervereinen gegründet wurden zum An- und Verkauf von billigen und haltbar gemachten Lebensmitteln für die Arbeiter. Basierend auf dieser Idee wurde auch in Wetzikon der «store», der sogenannten Konsum gegründet.
Zur Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert veränderten sich die Konsumgewohnheiten radikal. Die Arbeiterfrauen waren oft überfordert mit den langen Arbeitstagen in der Fabrik und dem Haushalt. Ihnen blieb wenig Zeit zum Kochen, geschweige denn für Gartenarbeit zur Selbstversorgung. Da der Tagesverdienst eines Arbeiters nur für eine karge, einseitige Ernährung reichte, beschränkte sich der Speisezettel auf einfachste Kartoffel- und Maisgerichte. Die Folgen waren Mangelerscheinungen und Krankheitsanfälligkeit.
Einer, der schon früh gemerkt hat, dass diese Zustände verändert werden müssen, war der Glarner Textilfabrikant Jean Jenny-Ryffel aus Schwanden. Er pflegte intensive Geschäftsbeziehungen zu England, dem Mutterland der Webmaschinen. Auf seinen zahlreichen Reisen beobachtete er die dortigen sozialen Zustände sehr genau. Dabei lernte er die «cooperative stores» kennen, Lebensmittelläden, die von Arbeitervereinen gegründet wurden zum An- und Verkauf von billigen Lebensmitteln für die Arbeiter. Basierend auf dieser Idee gründete er 1839 in Schwanden den ersten «store», den sogenannten Konsum.
1851 folgten die Grütlianer um Karl Bürkli, dem späteren Vorkämpfer der Sozialdemokratie, mit dem Konsumverein Zürich, und schon bald gab es Nachahmungen in der ganzen Schweiz. Konsumvereine waren selbstverwaltete Organisationen, die vor allem in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Genossenschaftsbewegung entstanden sind. Sie verkauften ihre Produkte in eigenen Läden gegen Barzahlung zu Tagespreisen.
Mit dem Aufkommen dieser Läden veränderten sich die Ernährungsgewohnheiten erneut. Der Speisezettel wurde vielfältiger, die Verpflegung gesünder. Anstatt mühsam im eigenen Garten Nahrungsmittel anzupflanzen, kaufte man sie nun immer öfter zu günstigen Preisen im Konsumverein. Zudem konnte man die Lebensmittel seit der Erfindung des Sterilisierens und der Konservendose auch haltbarmachen.
1890 entstand der Verband schweizerischer Konsumvereine (VSK), aus dem in einem jahrzehntelangen Konzentrationsprozess der heutige Grossverteiler Coop hervorging. Für die Entwicklung von Coop in der Schweiz ist speziell hervorzuheben, dass die Genossenschaften nicht nur als Selbsthilfeorganisationen in Arbeiterkreisen entstanden, sondern auch von bürgerlichen Kreisen (Philanthropen) gegründet wurden.
Am Beipiel von Coop in Wetzikon lassen sich die Veränderungen schön aufzeigen. 1969 fusionierte Coop mit Konsum unter dem Druck der wirtschaftlichen Lage und der immer stärkeren Konkurrenz. Der repräsentative Konsum aus dem Jahr 1908 des Wetziker Architekten Johannes Meier (1871–1956) musste 1976 einem einstöckigen, fast quadratischen Zweckbau in Waschbeton weichen, es entstand das Coop-Center. Weder interessierte damals eine befriedigende Gesamtwirkung noch nahm man auf Denkmalschutzobjekte besondere Rücksicht, wie dies laut dem neu eingeführten Planungs- und Baugesetz hätte geschehen müssen.
Anders als in den 1970er-Jahren, bemühte sich Coop bei seiner Vergrösserung 2002 um eine gute architektonische und städtebauliche Lösung. Der in Berlin tätige Architekt Max Dudler erhielt den Auftrag, den Stadtraum durch elegante Urbanität aufzuwerten und mit einem Wohn-, Geschäfts-, und Einkaufskomplex einen städtischen Ort zu schaffen. Entstanden ist eine architektonische «Skulptur», die einen neuen baulichen Massstab in der Stadt Wetzikon setzt. Der damals für viele unverständliche Verlust des ersten Konsums konnte mit einer aussergewöhnlichen architektonischen Leistung wieder wett gemacht werden.
Bereits 2005 erhielt dieser Bau den Architekturpreis des Architekturforums Zürcher Oberlands. Die Jury würdigt den Bau folgendermassen: «Im eher gesichtslosen, kleinmassstäblichen Zentrum von Wetzikon ist ein grosser, wahrhaft städtischer, polyfunktionaler Komplex mit kompromissloser Aussage in Figur und architektonischer Gestaltung entstanden. Die elegante Baumasse mit ihren vornehmen, auf die benachbarte Kirche bezogenen Sandsteinfassaden bewirkt mit ihrer urbanen Geste eine willkommene Aufwertung der angrenzenden Strassen- und Stadträume. Die wohlproportionierte Rasterstruktur und die ruhige Detaillierung erzeugen, wie etwa in der Eingangshalle, immer wieder Raumeindrücke von fast poetischer Aussage.».
Literatur
C. Doswald, Claudia Fischer-Karrer, Barbara Thalmann, die Industrielandschaft Zürcher Oberland, Bauma 2016.
C. Fischer-Karrer, S. Ryffel, S., Steeb, E. Zangger, Für immer verloren?, in: Heimatspiegel 8/2009.
(Claudia Fischer-Karrer, 2024)